BIM in der Fabrikplanung: Ganzheitliche Ansätze aus dem Forschungsprojekt FaBIM
von Franziska Wagner & Marcel Potthoff | 24. September 2025
Die Fabrik der Zukunft stellt Unternehmen und Planer:innen vor enorme Herausforderungen: steigende Anforderungen an Nachhaltigkeit und Energieeffizienz, kürzere Produktlebenszyklen und ein dynamisches Marktumfeld. Klassische Methoden stoßen dabei immer öfter an ihre Grenzen – Projekte dauern zu lange, werden teurer als geplant und verfehlen häufig ihre ursprünglichen Ziele.
Genau an diesem Punkt bietet Building Information Modeling (BIM) in der Fabrikplanung völlig neue Chancen. BIM ist weit mehr als ein digitales 3D-Modell – es ist eine kollaborative Methode, die Planung, Bau und Betrieb über eine gemeinsame Datenbasis verbindet. Während die Bauwirtschaft in größeren Projekten bereits von BIM profitiert, steckt die Integration von BIM in der Fabrikplanung noch in den Kinderschuhen. Genau an diesem Punkt setzt das Forschungsprojekt FaBIM zur digitalen Fabrikplanung an.
Zentrale Herausforderungen in der Produktions- und Fabrikplanung

Die Planung moderner Fabriken ist heute komplexer denn je. Neben Nachhaltigkeitszielen und dem steigenden Druck, klimaneutralen Produktionsstätten zu realisieren, verschärfen globale Lieferkettenkrisen und volatile Märkte die Situation. Unternehmen müssen ihre Produktionssysteme in immer kürzeren Abständen anpassen und benötigen Gebäude, die wandelbar und zukunftssicher sind.
Zusätzlich erschwert der Fachkräftemangel die Umsetzung großer Bauprojekte. Hinzu kommt: Kaum ein Bauprojekt ist so interdisziplinär wie eine Fabrikplanung:
- Architekt:innen denken in Gebäudestrukturen,
- Tragwerksplaner:innen in statischen und dynamischen Lasten,
- TGA-Planer:innen in Versorgungsnetzen,
- Fabrikplaner:innen in Materialflüssen,
- Betreiber:innen in langfristiger Wirtschaftlichkeit,
- Investor:innen in Kosten und Termintreue,
- Produktionsteams in Effizienz und Flexibilität.
Diese Vielzahl an Beteiligten führt zwangsläufig zu Schnittstellen, Zielkonflikten und Kommunikationsproblemen. Informationen werden oft mehrfach erfasst, gehen verloren oder erreichen die richtigen Stellen zu spät. Schon kleine Abstimmungsfehler können gravierende Folgen haben: Eine Maschine passt nicht auf das vorgesehene Fundament oder Medienanschlüsse liegen an der falschen Stelle und wurden nicht ausreichend dimensioniert.
Genau hier setzt BIM an. Durch Datenmodelle, standardisierte Informationsflüsse und eine zentrale Datenumgebung/ Common Data Envirnoment (CDE) entsteht eine gemeinsame Sprache für alle Projektbeteiligten. So wird es möglich, Architekt:innen, Tragwerksplaner:innen, Fabrikplaner:innen, Betreiber:innen und Investor:innen frühzeitig einzubinden, ihre Anforderungen transparent zu machen und Zielkonflikte bereits in der Planungsphase zu entschärfen. BIM sorgt damit nicht nur für technische Präzision, sondern auch für eine bessere Zusammenarbeit und Interoperabilität zwischen allen Beteiligten.
FaBIM: Das Forschungsprojekt und seine Partner:innen

Um diese Chancen zu nutzen, wurde 2022 das Forschungsprojekt FaBIM gestartet. Es vereinte Partner:innen aus Forschung, Softwareentwicklung, Beratung und Planung. Mit dabei waren das Fraunhofer IGCV, CONTACT Software, ifp consulting, Kohlbecker sowie wir, die BIM-GLW. Gemeinsam haben wir Methoden und Werkzeuge entwickelt, die eine durchgängige und ganzheitliche Fabrikplanung ermöglichen.
Um die Arbeit zu strukturieren, wurde das Projekt in drei Arbeitspakete (AP) gegliedert:
AP1: Entwicklung eines Informations-Lieferungs-Handbuchs (ILH/IDM)
Ziel war die Definition einheitlicher Anforderungen an den Informationsaustausch über alle Projektbeteiligten und Phasen hinweg. Das ILH – international als Information Delivery Manual (IDM) bekannt – legt fest, welche Informationen wann, in welcher Qualität und von wem bereitzustellen sind. Es schafft damit die Grundlage für einen durchgängigen, effizienten Informationsfluss.
AP2: Konzeption einer gemeinsamen Datenumgebung (CDE)
Dieses Arbeitspaket bildete das technische Fundament. Es ging darum, eine zentrale digitale Plattform zu entwickeln, in der alle relevanten Lebenszyklusdaten konsistent erfasst, verwaltet, ausgetauscht und visualisiert werden können.
AP3: Kontinuierliche Potenzialanalyse
Um den Mehrwert des entwickelten Ansatzes messbar zu machen, wurden methodische und wirtschaftliche Potenziale laufend identifiziert, bewertet und dokumentiert.
Durch diese klare Struktur gelang es, wissenschaftliche Ansätze mit praktischen Anforderungen zu verbinden und eine Lösung zu entwickeln, die sowohl in der Forschung als auch in realen Projekten Mehrwert stiftet.
Bau und Fabrikplanung: Zusammenwachsen zweier Disziplinen
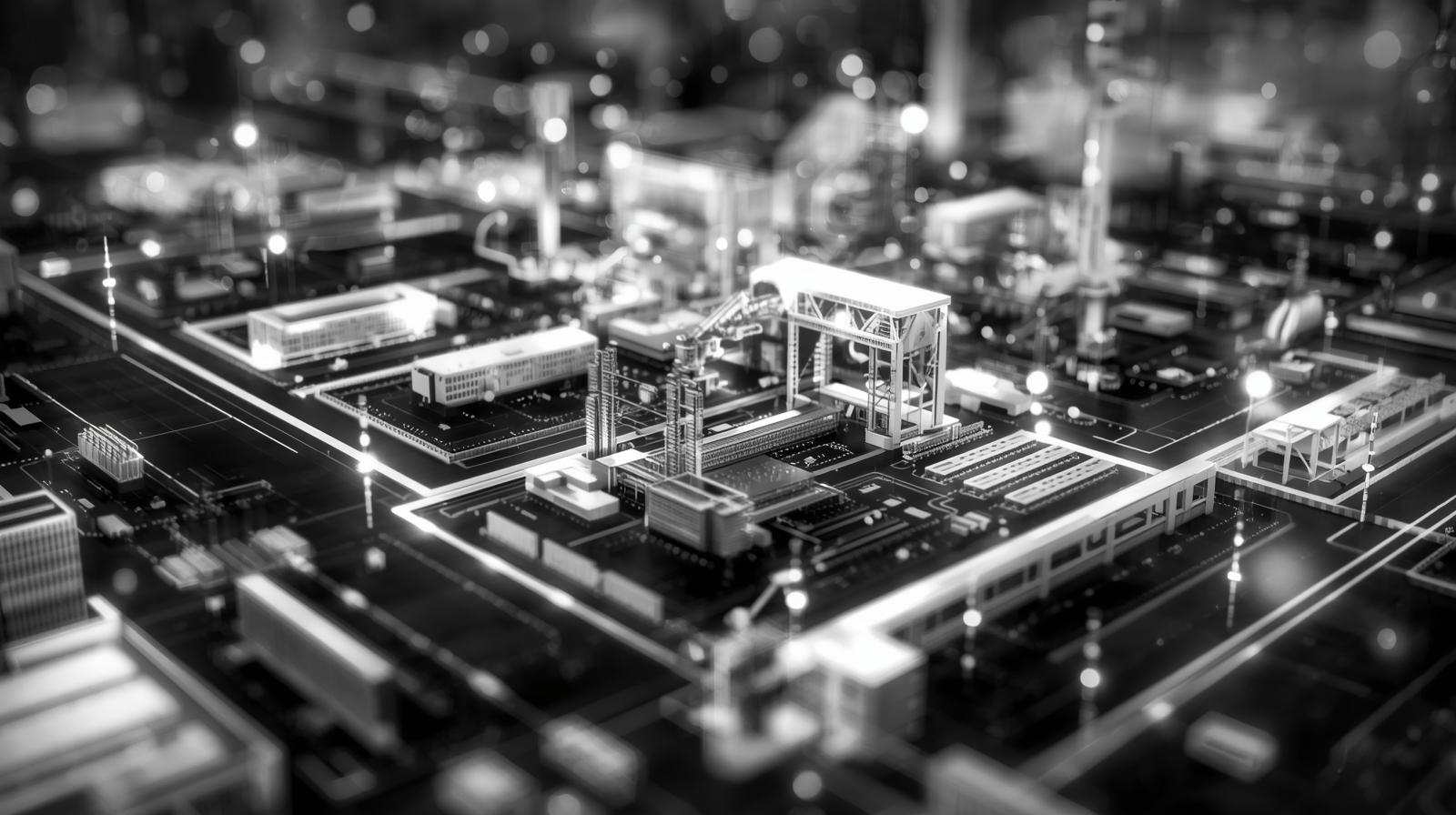
Building Information Modeling ist in der Baubranche schon seit einigen Jahren etabliert. Architekt:innen und Fachplaner:innen nutzen BIM, um Bauprojekte effizienter und kollaborativer umzusetzen. BIM-Modelle werden digital erstellt, Prozesse lassen sich besser koordinieren, Kollisionen frühzeitig erkennen und Nachträge reduzieren.
In der Fabrikplanung hingegen dominieren noch oft klassische Methoden. Hier geht es um Maschinenlayouts, Materialflüsse, Lagertechnik und Logistik. Viele Entscheidungen beruhen auf Insellösungen in Simulationssoftware. Ein durchgängiger, standardisierter Informationsaustausch existiert selten.
Dabei sind Bau- und Fabrikplanung eng miteinander verzahnt:
- Das Tragwerk eines Gebäudes muss die Lasten geplanter Maschinen aufnehmen können.
- Die TGA muss Medien wie Druckluft, Wasser oder Strom genau dort bereitstellen, wo die Produktion sie benötigt.
- Die Gebäudehülle und das Tragwerk müssen flexibel genug sein, um spätere Anpassungen im Produktionslayout zu ermöglichen.
Mit BIM für Fabrikplanung können diese Abhängigkeiten frühzeitig sichtbar gemacht werden. Digitale Zwillinge erlauben es, Bau- und Produktionsmodelle zusammenzuführen und Schnittstellen zwischen den Disziplinen klar zu definieren.
Um die Potenziale greifbar zu machen, wurden im Projekt zunächst über 300 Anwendungsfälle aus Bau- und Fabrikplanung gesammelt, bewertet und konsolidiert. Am Ende blieben vier zentrale Szenarien übrig:
- Fabrikplanung im Bestand (Brownfield)
- Koordination und Kollisionsprüfung
- Digitaler Zwilling
- Bestandsermittlung
Diese Anwendungsfälle bildeten den Kern für die Ausarbeitung von Prozessen und Methoden. Sie zeigten besonders deutlich, wie wichtig ein durchgängiger Datenfluss über alle Disziplinen hinweg ist.
Nahtlose Zusammenarbeit durch intelligentes Schnittstellen-Management

Ein Fabrikbauprojekt bringt zahlreiche Akteur:innen an einen Tisch: Architekt:innen, Bauingenieur:innen, TGA-Planer:innen, Fabrikplaner:innen, Betreiber:innen, Investor:innen und viele mehr. Jede Schnittstelle ist eine potenzielle Fehlerquelle – Informationen können verloren gehen, doppelt gepflegt oder zu spät übermittelt werden.
Deshalb legten wir bei FaBIM ein besonderes Augenmerk auf das Schnittstellen-Management.
Mit dem Informations-Lieferungs-Handbuch (IDM) wurde festgelegt, welche Partei zu welchem Zeitpunkt welche Information in welcher Form bereitstellt. Dabei ging es nicht nur um klassische Dokumente wie Planerverträge oder Kostenschätzungen, sondern insbesondere um die präzise Definition von BIM-Modellen.
Gerade bei BIM-Modellen ist der Informationsbedarf deutlich differenzierter:
- Für kritische Bauteile – etwa Fundamente, Medienanschlüsse oder spezielle Produktionsanlagen – wurden spezifische Anforderungen an den Informationsgehalt definiert.
- Zwei Dimensionen der Detaillierung wurden unterschieden: Level of Geometry (LOG) für die geometrische Detailtiefe und Level of Information (LOI) für die alphanumerischen Attribute.
Diese Struktur stellte sicher, dass die gelieferten BIM-Modelle tatsächlich die Anforderungen der jeweils anderen Disziplin abdeckten.
Parallel dazu wurde eine CDE aufgebaut. Sie bildete die technische Grundlage, um Informationen konsistent und versionssicher zu verwalten. Rollenbasierte Zugriffsrechte sorgen dafür, dass jede:r Beteiligte nur die relevanten Inhalte sieht, gleichzeitig aber immer auf den aktuellen Datenstand zugreifen kann.
Die Verbindung von IDM und CDE erwies sich als Schlüssel: Während das IDM die Regeln definiert, sorgte die CDE für deren praktische Umsetzung. So entsteht ein transparentes, verlässliches und effizientes Informationsmanagement über den gesamten Projektverlauf hinweg.
Wege in die Zukunft: Fazit und Forschungsperspektiven

FaBIM hat eindrucksvoll gezeigt, wie groß das Potenzial von BIM in der Fabrikplanung ist. Prozesse werden transparenter, Abstimmungen effizienter und Fehlerquoten sinken spürbar. Besonders in komplexen Projekten profitieren Bauherr:innen, Betreiber:innen und Planer:innen gleichermaßen von einem klar definierten Informationsmanagement und einer gemeinsamen Datenbasis.
Gleichzeitig bleibt Forschungsbedarf: Die Standardisierung relevanter Projektdokumente ist noch nicht abgeschlossen, die Integration von Nachhaltigkeitskennzahlen und Energiedaten steht erst am Anfang, und die durchgängige Nutzung des digitalen Zwillings über den gesamten Lebenszyklus hinweg eröffnet weitere Chancen.
Eines ist jedoch klar: Die Fabrik der Zukunft wird digital geplant, gebaut und betrieben. Mit Projekten wie FaBIM schaffen wir die Grundlagen dafür – praxisnah, interdisziplinär und mit einem klaren Blick auf den Mehrwert für Bauherr:innen und Anwender:innen.
Gemeinsam mit der Building Information Cloud GLWG GmbH vertiefen wir dieses Thema weiter. In einem kommenden Beitrag widmen wir uns fabrikplanungsspezifischen Qualitätsprüfungen, etwa der Überprüfung der Standsicherheit von Produktionssystemen. Damit zeigen wir, wie sich BIM nicht nur für den Informationsaustausch, sondern auch für die Sicherstellung höchster Qualitätsstandards in der Fabrikplanung einsetzen lässt.
Lassen Sie uns gemeinsam den digitalen Aufbruch gestalten. Jetzt ist die Zeit umzudenken!
Entdecken Sie unsere Referenzprojekte und erfahren Sie, wie unsere Zusammenarbeit konkrete Mehrwerte schafft – für alle Entscheidungsträger, die Bauprojekte digital, nachhaltig und effizient realisieren möchten.
Sie haben eigene Ideen oder Ansätze? Wir freuen uns über neue Partnerschaften.